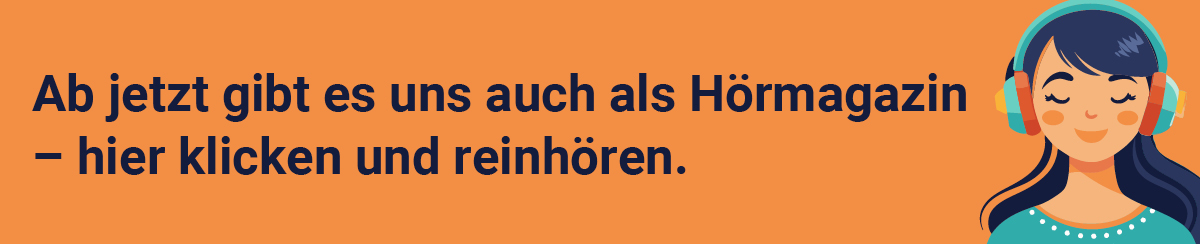Clusterkopfschmerz zählt zu den seltenen Krankheiten und ist bislang wenig bekannt. Es ist eine der schwersten Kopfschmerzerkrankungen überhaupt. Der durch die Krankheit ausgelöste Schmerz kann in den schlimmsten Momenten unaushaltbar stark werden. In Deutschland sind schätzungsweise etwa 120.000 bis 200.000 Menschen daran erkrankt. Einer von ihnen ist Frank Paulus. Mit 48 Jahren bekam er seine erste Attacke.
Herr Paulus, wann hatten Sie Ihre erste Attacke?
Ich erinnere mich noch genau daran. Es war im Frühling 2012. Ich spürte plötzlich einen starken, stechenden Schmerz um mein linkes Auge herum. Mein Gesicht verzerrte sich, das Auge begann zu tränen, die Nase zu laufen, das linke Augenlid hing leicht herunter und Schweiß bildete sich auf meiner Stirn. Der Schmerz war unerträglich. Ich begann unruhig in der Wohnung umherzulaufen und wusste nicht, wie mir geschieht, was ich machen sollte. Nach rund 15 Minuten war es wieder vorbei.
Können Sie versuchen, den Schmerz genauer zu beschreiben?
Es fühlte sich an, als würden mir glühende Nadeln oder Messer durch das linke Auge gestoßen, bevor sich dieses Stechen langsam in Richtung Stirn und Schläfen ausbreitete – als würden sich Pfeile langsam durch meinen Schädel bohren.
Wie ging es weiter?
Als ich am nächsten und übernächsten Tag wieder eine Attacke bekam, ging ich auf Drängen meiner Frau zum Hausarzt. Bei ihm im Sprechzimmer bekam ich erneut eine Attacke und der Arzt schaute mich völlig entsetzt an. Er sagte, dass er so etwas noch nie zuvor gesehen hatte, und wies mich sofort mit Verdacht auf Hirntumor ins Krankenhaus ein. Als ich meine Frau anrief, um ihr davon zu erzählen, zitterte ich am ganzen Körper. Ich stand unter Schock und hatte panische Angst vor dem, was kommt. Ich war gerade Opa geworden, und statt mich auf die gemeinsame Zeit mit meinem Enkel zu freuen, hatte ich nun Angst davor, zu sterben und ihn nicht aufwachsen zu sehen. Dieser Gedanke brach mir das Herz.
Im Krankenhaus wurden körperliche Untersuchungen, Laboruntersuchungen und ein CT gemacht. Danach gaben die Ärzte Entwarnung und schickten mich nach Hause. Da ich auch im Krankenhaus mehrere Attacken hatte, wurde mir noch geraten, zum Neurologen zu gehen.
Wie fühlten Sie sich in diesem Moment?
Sehr alleingelassen. Ich wusste zwar, dass ich nicht an einer lebensbedrohlichen Krankheit litt, was mich sehr erleichterte. Doch die Frage „Was habe ich dann?“ konnte mir niemand beantworten.
Wusste der Neurologe weiter?
Leider nein. Er empfahl mir, mehr zu trinken, an der frischen Luft spazieren zu gehen und, wenn es gar nicht anders geht, eine Schmerztablette zu nehmen. Er verschrieb mir Schmerzmittel und schickte mich nach
Hause. Ich befolgte seinen Rat, und nach zwei Monaten waren die Attacken wieder weg.
Doch sie kamen wieder.
Ein halbes Jahr hatte ich keinerlei Probleme, doch im Herbst waren sie wieder da. Von da an suchte mich der Schmerz jedes Jahr um die Zeitumstellung auf. Bis zu sechs Wochen litt ich täglich unter den qualvollen Attacken, die bei mir bis zu 50 Minuten andauerten und teilweise achtmal am Tag auftraten. Ich habe viele Wartezimmer von innen gesehen, doch kein Arzt konnte mir helfen. Irgendwann habe ich resigniert und bin wegen meiner Schmerzen zu keinem Arzt mehr gegangen. Damals war ich mir sicher, dass ich den Rest meines Lebens unter diesen Höllenqualen leiden muss.
Wie hat die Erkrankung Ihr Leben verändert?
Ich erkannte mich oft selbst nicht wieder. Ich war immer ein sehr kontaktfreudiger Mensch, der gern in Gesellschaft war, und liebte es, Ausflüge mit meiner Familie zu unternehmen. Durch die Attacken veränderte ich mich. Ich zog mich immer mehr zurück, meine Lebensfreude und das Familienleben litten sehr darunter. Ich konnte nicht mehr der Vater, Opa und Ehemann sein, der ich sein wollte. Wenn mein Enkel während einer Attacke zu mir kam, ich ihn wegschicken musste und die Enttäuschung und Traurigkeit in seinem Gesicht sah, brach es mir fast das Herz. Auch beruflich war es schwer. In den Attackenwochen musste ich mich oft krankschreiben lassen. Mein Chef hatte zum Glück Verständnis dafür, aber ich hatte das Gefühl, meine Kollegen im Stich zu lassen. Hinzu kam, dass ich immer mehr resignierte, weil kein Arzt mir helfen konnte. Teilweise fühlte ich mich wie ein Simulant.
Wann bekamen Sie endlich die Diagnose?
Die Diagnose erhielt ich neun Jahre nach meiner ersten Attacke. Mein Enkelsohn war im Kindergarten vom Klettergerüst gefallen und lag mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Als ich ihn besuchte, bekam ich eine Attacke. Dies sah der Stationsarzt und bat mich in sein Sprechzimmer. Er zog eine Kollegin aus der Neurologie hinzu und beide stellten mir Fragen. Danach bekam ich die Diagnose Clusterkopfschmerzen. Als sie mir sagten, dass es Behandlungsmöglichkeiten gibt, war ich so glücklich wie schon lange nicht mehr. Dass ich vor drei Jahren zur richtigen Zeit am richtigen Ort eine Attacke hatte, war ein Segen. Sonst wüsste ich vielleicht heute noch nicht, was ich habe.
Wie wurden Sie dann therapiert?
Anfangs mit Tabletten. Doch leider wirkten diese nicht so, wie ich gehofft hatte. Wenn eine Attacke begann und ich die Tablette nahm, wirkte diese scheinbar erst, als die Attacke am Abklingen war. Das frustrierte mich sehr. Jetzt hatte mein Leiden zwar einen Namen, doch es änderte nicht wirklich etwas an meiner Situation. Zum Glück hat sich in den letzten Jahren viel getan.
Bitte gehen Sie näher darauf ein.
Leider ist die Erkrankung bisher nicht heilbar, aber die heute gängigen Behandlungsmethoden bieten eine gute Linderung der Schmerzen. Mit den Möglichkeiten lässt sich die Anzahl, aber auch die Heftigkeit der Schmerzattacken senken. In Akutsituationen nutze ich Sauerstoff und eine Behandlung via Injektion oder Nasenspray – je nach Situation und Schwere der Attacke. Besonders die Möglichkeit der Injektion hat mein Leiden stark verbessert, da die Wirkung schnell einsetzt und ich sie überall nutzen kann. Es gibt auch prophylaktische Möglichkeiten, doch diese haben bei mir leider keine Wirkung gezeigt.
Wie geht es Ihnen heute?
Deutlich besser. Ich habe gelernt, mit meiner Erkrankung zu leben, führe Schmerztagebuch, bin in regelmäßigem Austausch mit meinem Neurologen und habe dank der Therapie meine Lebensfreude größtenteils zurückgewonnen. Natürlich gibt es auch schlechte Tage, aber die vergehen schnell wieder. Dafür bin ich sehr dankbar.
Das Interview führte Emma Howe