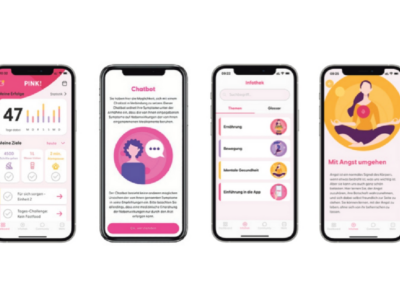Hubert Harbacher lebt aktiv, reist viel, arbeitet gern und ist eng mit seiner Familie verbunden. Nichts deutet darauf hin, dass sein Leben sich grundlegend verändern wird. Als er im März 2018 die Diagnose metastasierter Prostatakrebs erhält, bricht für ihn eine Welt zusammen. Heute, fast acht Jahre später, spricht er gemeinsam mit seiner Frau Doris über diesen Einschnitt. Über Angst, Nähe und darüber, wie Liebe Halt geben kann, wenn das Leben aus dem Gleichgewicht gerät.
Herr Harbacher, Frau Harbacher, Sie sind seit vielen Jahren ein Paar. Wie würden Sie Ihr gemeinsames Leben vor der Diagnose beschreiben?
Hubert: Ich habe als Techniker gearbeitet. Manchmal war das sehr stressig, auch mit Wochenendeinsätzen. Trotzdem bin ich gern zur Arbeit gegangen. Dadurch, dass ich Teilzeit gearbeitet habe, hatte ich viel Freiraum für unsere Enkelkinder. Ich habe sie aus der Kita abgeholt, aus der Schule, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Das hat mir sehr gefallen. Wir waren auch viel unterwegs. Reisen war ein großer Teil unseres Lebens. Vor rund 20 Jahren haben wir angefangen, regelmäßig nach Asien zu reisen. Das war intensiv und erfüllend. Wir waren aktiv, viel mit dem Fahrrad unterwegs, haben Urlaube geplant und gelebt. Es war ein sehr gutes Leben.
Doris: Ich bin Hebamme. Meine Arbeit ist nah am Leben. Und sie ist fordernd. Wir haben unsere Urlaube immer so gelegt, dass ich freimachen konnte. Dann sind wir los. Das war unser Rhythmus. Wir leben seit Jahren in Hamburg. Hubert ist gebürtiger Oberbayer. Dieses Bodenständige hat er bis heute.
Wie haben Sie Ihren Körper vor der Diagnose wahrgenommen? Gab es Warnsignale?
Hubert: Nein, gar keine. Keine Schmerzen, kein Unwohlsein. Nichts. Es gab nur eine Sache, die mir im Nachhinein aufgefallen ist. Die Menge des Ejakulats wurde deutlich weniger. Damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Erst später habe ich gelesen, dass das ein mögliches Anzeichen für Prostatakrebs ist. Aber sonst habe ich nichts gespürt.
Doris: Außer deinen plötzlichen Rückenschmerzen.
Hubert: Ja, und sie wurden immer schlimmer. Es gab keine klare Erklärung. Ich wurde eingerenkt, habe Schmerzmittel bekommen und es wurde auf Stress und Psyche geschoben. Zwei Ärzte, und niemand hat wirklich hingeschaut. Unsere beste Freundin arbeitet bei unserem Hausarzt. Sie hat gesagt, da stimmt etwas nicht. Sie hat dafür gesorgt, dass ich untersucht werde und ein MRT bekomme. Kurz darauf kam der Befund. Er war massiv.
Was zeigte das MRT?
Hubert: Die gesamte Wirbelsäule, der ganze Rumpf, das knöcherne Skelett – voller Metastasen. Da war klar, woher die Rückenschmerzen kamen. Unklar war zuerst, wo der Primärkrebs sitzt, Lunge oder Prostata. Das passte beides zu diesem Metastasenmuster. Dann kam der PSA-Wert. Normal ist bis 4. Ich hatte 184. Damit war es klar: unheilbarer Prostatakrebs.
Wie haben Sie auf die Diagnose reagiert?
Hubert: Es hat mir regelrecht den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich wusste nicht mehr, wo unten und oben ist. Ich war überzeugt, dass ich sehr bald sterbe. Ich hatte mindestens zwei Jahre keinen Halt mehr.
Doris: Ich erinnere mich sehr genau an diesen Moment und wusste von Anfang an, dass wir das schaffen. Ich habe das nicht gesagt, um Hubert zu beruhigen. Ich war felsenfest überzeugt davon.
Wie ging es danach weiter? Welche Therapie haben Sie bekommen?
Hubert: Alle drei Monate bekomme ich ein Medikament gespritzt und ich nehme täglich eine Tablette gegen das Metastasenwachstum. Die Aktivität des Krebses ging sehr schnell auf null. Und so ist es bis heute geblieben. Das hängt damit zusammen, dass Testosteron unterdrückt wird. Das Hormon, von dem der Krebs sich ernährt.
Wie haben Sie die ersten Monate nach der Diagnose erlebt?
Hubert: Ich habe funktioniert. Nach außen war ich da. Aber innen war ich weg. Der Gedanke, an Krebs stirbt man, hat mich gequält. Ich habe viel an meinen eigenen Tod gedacht. Das ging tief. Ich hatte Depressionen und habe sogar über Selbstmord nachgedacht. Das auszusprechen, ist hart. Aber es war so. Ich habe nicht zu hoffen gewagt, dass ich damit leben kann.
Doris: Das war die schlimmste Zeit. Weil er körperlich da war, aber innerlich in einem dunklen Raum. Ich habe ihn nicht alleingelassen, aber für mich war auch klar, dass es so nicht weitergehen kann. Ich habe Hubert sehr deutlich gesagt, dass er sich Hilfe holen muss.
Haben Sie Hilfe bekommen, Herr Harbacher?
Ja, ich hatte einmal einen Termin bei einem Psychologen. Eine Stunde, privat bezahlt. Er sagte einen Satz, den ich nie vergessen werde: „Es geht nicht darum, dass Sie an Krebs sterben, sondern dass Sie mit dem Krebs leben.“ Das hat einen Schalter bei mir umgelegt. Zudem nehme ich einen Stimmungsaufheller. Eine kleine Dosis jeden Morgen. Das hat mir geholfen, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. Ich bin dankbar, dass ich lebe. Und dass ich nicht allein lebe. Ich habe meinen Lebensmut durch die Stärke meiner Frau wiedergefunden.
Was hat Ihnen geholfen, Frau Harbacher?
Struktur, Nähe und die gemeinsame Entscheidung, dass wir unser Leben nicht anhalten. Wir haben geweint, wir haben geschwiegen. Aber wir haben nie aufgehört, ein Paar zu sein und füreinander da zu bleiben.
Sie sagen beide, die Nähe wurde stärker. Wie hat sich das gezeigt?
Hubert: Sehr konkret. Wir hatten vor der Diagnose über Jahre getrennt geschlafen. Nach der Herzoperation meiner Frau stand das Bett höher. Sie schlief besser allein. Ich bin in ein anderes Zimmer gezogen. Nach der Diagnose habe ich gefragt, ob ich zurückkommen darf. Wir haben sofort ein neues Bett gekauft, neue Matratzen, das Schlafzimmer anders gestaltet – unser Liebesnest.
Doris: Wir gehen gern ins Bett. Wirklich. Wir freuen uns darauf. (lacht) Wir haben unsere Rituale. Hubert liest meistens Nachrichten auf dem Handy, dann ein Buch. Ich mache ein Kreuzworträtsel. Manchmal reden wir. Manchmal liegen wir einfach da. Da ist sehr viel Nähe zwischen uns, viel mehr als vor der Diagnose.
Auch die körperliche Nähe?
Doris: Ja, und manchmal ist sie sogar zu viel. Ich muss ihn im Bett manchmal ein bisschen wegschubsen, damit ich Platz habe. (lacht)
Hubert: Das stimmt. (beide lachen)
Herr Harbacher, Sie sagen, Ihr Gefühl von Mannsein habe sich verändert.
Ja, die Therapie fährt ja das Sexualhormon Testosteron herunter. Die Libido geht zurück. Sexualität wird anders. Und manchmal tut das weh. Aber es hat mir auch eine neue Gefühlswelt eröffnet. Weg vom Körperlichen. Hin zu etwas, das ich früher nicht kannte. Die Liebe zu meiner Frau hat sich verfestigt. Meine Frau ist für mich der Anker und das Leben. Das klingt groß., aber ich meine es genau so.
Und was hat sich durch die Erkrankung noch bei Ihnen verändert?
Ich bin heute glücklicher. Und ich fühle mich besser denn je. Das sagt man nicht leicht. Ich meine nicht, dass Krebs gut ist. Ich meine, dass ich anders lebe, bewusster. Wir erleben viele gemeinsame Glücksmomente, kleine und große. Dass ich sie erleben darf, ist für mich nicht selbstverständlich. Und genau darin liegt heute meine größte Dankbarkeit.
Wie sehen diese Glücksmomente aus?
Hubert: Radfahren mit meiner Doris. Das klingt klein, aber es ist riesig. Wenn wir durch Hamburg oder raus ins Grüne radeln, bin ich manchmal so glücklich, dass ich keine Worte finde.
Doris: Und wir reisen und lachen viel gemeinsam. Ich liebe Huberts Humor – und er meinen.
Ihre Geschichte ist auch im Buch „Tief in mir“ erschienen. Was hat es für Sie bedeutet, Ihre Erfahrungen dort zu teilen?
Hubert: Das war für mich ein großer Schritt. Ich war lange sehr zurückhaltend mit meiner Diagnose. Ich habe nur wenigen Menschen davon erzählt. Als ich von dem Buchprojekt gehört habe, habe ich zuerst meine Frau gefragt, ob es für sie in Ordnung ist. Das war mir wichtig. Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich zugesagt habe. Es hat mir geholfen, meine eigene Geschichte anzunehmen. Und wenn jemand beim Lesen merkt, ich bin nicht allein mit meinen Gedanken und meiner Angst, dann hat es sich gelohnt.
Doris: Für mich war wichtig, dass es ehrlich bleibt. ohne Schönreden. Genau so ist es auch geworden. Ich finde es gut, dass Hubert sich gezeigt hat. Nicht als Held, sondern als Mensch – so wie bei diesem Interview, das wir heute führen, auch.
Wenn Sie an die Zeit vor der Diagnose denken. Was würden Sie Ihrem früheren Ich sagen?
Hubert: Geh sorgsamer mit dir um und sprich aus, was dir nicht passt. Das konnte ich früher nicht, und das hat unserer Beziehung geschadet. Ich komme aus einem kleinen Bergdorf in Bayern, da lernt man nicht, über Gefühle zu sprechen. Heute kann ich das, und ich bin sehr froh, dass ich es noch lernen durfte.
Was möchten Sie anderen Betroffenen und ihren Partnern mitgeben, die gerade am Anfang dieser Reise stehen?
Hubert: Machen Sie es zu Ihrem Weg. Nicht zu dem Weg von anderen. Jeder hat seinen eigenen Krebs. Das klingt hart, aber es stimmt. Nehmen Sie Hilfe an, aber lassen Sie sich nicht fremdsteuern.
Doris: Und reden Sie miteinander. Als Paar. Oder mit jemandem, dem Sie vertrauen. Wenn Sie allein sind, suchen Sie Kontakt, zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe. Wir haben das nicht gemacht, doch wir haben uns.
Hubert: Und noch etwas: Entscheiden Sie selbst, ob Sie über Ihre Krankheit sprechen möchten und mit wem. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Manche wollen es privat halten, andere nicht. Beides ist in Ordnung.
Wenn Sie an die kommende Zeit denken: Was wünschen Sie sich für Ihr gemeinsames Leben?
Hubert: Dass wir es weiter so bewusst leben. Nicht größer, nicht schneller, sondern nah. Ich wünsche mir Zeit miteinander. Gesundheit, so gut sie eben möglich ist. Und viele ganz normale Tage, an denen wir zusammen lachen und uns freuen, abends gemeinsam ins Bett zu gehen.
Doris: Ich wünsche mir, dass wir neugierig bleiben. Aufeinander und auf das Leben. Dass wir weiter reisen, weiter radeln und uns an kleinen Dingen freuen. Und dass wir dieses Vertrauen behalten, dass wir alles, was kommt, gemeinsam schaffen können.
Das Interview führte Emma Howe.