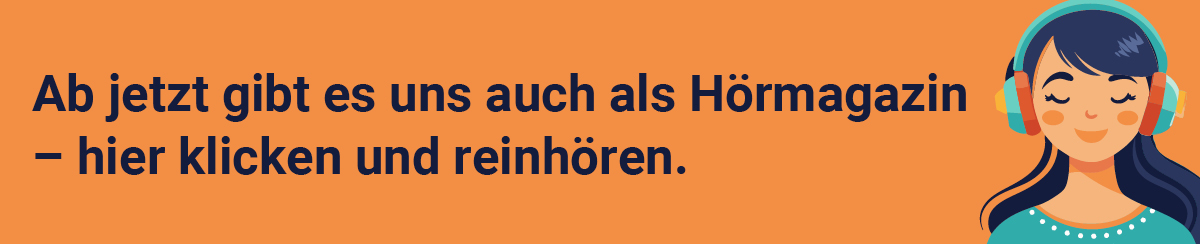Im Interview spricht die beliebte Schauspielerin, Sängerin und Autorin Katy Karrenbauer über die Demenzerkrankung ihres Vaters und erzählt, warum sie Angehörigen rät, sich mit der Materie des Vergessens auseinanderzusetzen.
Frau Karrenbauer, Sie waren gerade im Krankenhaus. Was ist passiert?
Ich wurde an der Halsschlagader operiert und leider musste es recht schnell gehen, da ich eine TIA, eine Vorstufe eines Schlaganfalls, erlitten habe. Das machte sich einige Tage zuvor durch eine lahme Hand bemerkbar, die ich nicht mehr richtig bewegen konnte. Und obwohl dieser Zustand nur wenige Minuten anhielt, dachte ich sofort: „Könnte das ein Schlaganfall gewesen sein?“ Gott sei Dank habe ich das nicht auf die leichte Schulter genommen, ansonsten könnte ich Ihnen vielleicht jetzt kein Interview geben. Nachdem ich meine Venen kontrollieren ließ, war klar, ich habe ein arterielles Problem. Durch die Feinsinnigkeit der Dame, mit der ich im Hubertus-Krankenhaus telefonierte und die mich bat, mich sofort in die Erste Hilfe zu begeben, habe ich eine Chance bekommen. Ihren Namen werde ich nie vergessen: Frau Fengler.
Und wie geht es jetzt weiter?
Prof. Dr. Weigang und sein Team haben mich operiert und ich bin dem ganzen Krankenhaus unendlich dankbar für die schnelle Hilfe und die warmherzige Art, mit der ich dort, genau wie andere Patienten, behandelt wurde. Nun steht eine weitere Operation auf der anderen Seite an und ich hoffe sehr, dass ich auch diese gut überstehe. Allerdings gibt es immer ein kleines Risiko, während der OP einen Schlaganfall zu erleiden. Ich bleibe aber zuversichtlich, dass ich mit einem Schrecken und zwei Narben am Hals davonkomme.
Neben Ihren eigenen gesundheitlichen Herausforderungen pflegen Sie Ihren an Demenz erkrankten Vater. Über 50 Jahre hatten Sie kaum Kontakt zueinander. Wie kam es dazu, dass Sie ihn nach Berlin geholt und in Ihr Leben eingeladen haben?
Seine zweite Frau rief mich Ende 2018 an und bat mich, da sie sich gesundheitlich nicht wohlfühle und sich selbst im Krankenhaus „durchchecken“ lassen wollte, mich zwei bis drei Tage um meinen Vater zu kümmern, der selbst im Krankenhaus war und nun entlassen werden sollte. Das war sehr ungewöhnlich. Vielleicht ahnte sie damals, dass er dement sein könne, sie sprach aber nicht darüber. Ohne zu zögern, bin ich damals nach Duisburg gefahren und habe meinen Vater abgeholt. Daraus entstand eine lange Odyssee, denn kurze Zeit später verstarb sie an schwerem Krebs und mein Vater blieb zurück. Ich musste sein geliebtes Haus verkaufen, um seine Pflege zu finanzieren, und brachte es nicht übers Herz, ihn in dieser Situation alleinzulassen. Darum habe ich sie in den Tod begleitet, bis zum letzten Atemzug, ihn zurück ins Leben.
Wie hat sich die Erkrankung gezeigt?
Das weiß ich nicht, da er wohl schon an Demenz erkrankt war. Aber ich erinnere mich gut, dass ich mich darüber wunderte, dass er bei den seltenen Telefonaten, die wir führten, weil er den Kontakt im Alter zu mir suchte, den Lautsprecher anmachte, was mich sehr störte, denn aus dem Hintergrund rief sie ihm immer die Antworten auf meine Fragen zu.
Wie sind Sie und Ihr Vater mit der Diagnose umgegangen?
Ich war geschockt und hatte Angst. Ich kannte ihn ja kaum, ich wusste nur, dass er sehr stur sein kann, aber ich wusste nicht, wie ich das bewältigen soll. Er selbst war und ist sich bis heute nicht darüber klar, dass er an Demenz erkrankt ist, und absolut alles, was ich über die Krankheit gelesen habe, ist auch bei ihm eingetroffen. Wut, Verzweiflung, das stete Vergessen bis hin zu einer Situation neulich, in der er mir sagte, er sei nicht mein leiblicher Vater, er habe nur Söhne. Ich bin viele Jahre im Tränenmeer geschwommen, vor allem wenn er mich nachts anrief und forderte, dass ich ihn zu Oma und Opa bringe, da sie auf ihn warten würden, und ich mit meiner Ehrlichkeit nicht zu ihm durchdrang. Das, was ich ihn aber von Anfang an gebeten habe, nämlich mir zu vertrauen, das hat bis heute Bestand, und auch wenn er manchmal sehr weit weg ist, dringe ich damit zu ihm durch. Nicht immer, vor allem immer weniger, aber ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass ich ihm einen schönen Lebensabend bereiten kann, obwohl die Krankheit mit voller Wucht zugeschlagen hat und man es kaum erträgt, einem Menschen beim „Verblühen“ zuzusehen.
Sie sagen, dass Sie sich in die Materie des Vergessens eingearbeitet haben.
Ja, das habe ich. Wenn ich mit ihm zusammen bin, also nahezu täglich, gehe ich mit ihm auf seine Reise in die Vergangenheit und ins Vergessen. Dabei ist wichtig, dass ich am Ende meines Besuches versuche, ihn wieder im Hier und Jetzt zu verorten, ihm immer wieder sage, dass wir in Berlin leben, und ihm auch Orte zeige, die nur in Berlin sein können. Das ist mühsam, aber oft lohnt es sich, und so haben wir die letzten fünfeinhalb Jahre gut zusammen verbracht und ich habe einen Menschen kennengelernt, der viele meiner Ansichten teilt, dem ich sehr ähnlich bin und der sich viel Mühe gibt, am Leben Freude zu haben. Das ist toll.
Was sind die größten Herausforderungen im Umgang mit der Erkrankung?
Zurzeit ist es für mich persönlich die größte Herausforderung, ihn vom Weglaufen abzuhalten. Die Türen des Altersheims sind geöffnet, da man die Menschen nicht ihrer Freiheit berauben darf. Zweimal war er schon weg, einmal habe ich ihn per Fahndung suchen lassen müssen, als ich selbst bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg engagiert war. Er fand das im Nachhinein „kein großes Ding“, als die Polizei ihn einfing und nach Hause brachte. Das bereitet mir gerade großen Kummer, denn ich kann nicht dauerhaft neben ihm sitzen und ihn unterhalten, was er sich am liebsten wünschen würde. Aber auch dann möchte er zur Straßenbahn und wird ungehalten, wenn ich ihm sage, dass es diese Straßenbahn nicht gibt und ich nicht einmal wüsste, wohin ich ihn mit dem Rollstuhl, den ich für längere Strecken benutze, schieben könnte. Aber alles in allem ist eigentlich alles eine Herausforderung, denn man versteht überhaupt nicht, dass der andere Mensch etwas sieht, was man selbst nicht sieht, den Ort, an dem man täglich ist, nicht erkennt oder zum Beispiel in seinem Zimmer sitzt und glaubt, kein einziges Möbel- oder Kleidungsstück würde ihm gehören. Bilder zeigen scheinbar andere Menschen, seine verstorbene Frau etwa erkennt er oft nicht auf Bildern. Er behauptet dann, das sei seine Mutter, und so kommt man ungeahnt von einer schwierigen Situation in die nächste, obwohl man noch bis eben dachte, er sei vollkommen klar in diesem Moment.
Welche Erkenntnisse oder Lehren haben Sie aus Ihrer bisherigen Reise mit Ihrem Vater gewonnen?
Man darf selbst keine Angst haben vor der Krankheit. Das macht es dem erkrankten Menschen und einem selbst leichter, damit umzugehen. Vieles, was gesagt wird, darf man nicht zu ernst nehmen, denn es kommt auch vor, dass der Erkrankte sehr zornig wird und Dinge sagt, die er ganz sicher nicht so meint. Es ist wirklich eine komplett „andere Welt“, in der sich die Menschen befinden. Dazu sollte man sich dringend Hilfe und Unterstützung holen, damit man zwischenzeitlich selbst Kraft tanken kann, und man muss lernen, sich selbst zu verzeihen, dass man nicht unfehlbar ist.
In den letzten Jahren bin ich immer sofort gesprungen, wenn er etwas brauchte, wegzulaufen drohte oder mich aufforderte, sofort zu kommen und ihn abzuholen, die Polizei zu rufen, weil sein Auto, das er nicht besitzt, gestohlen wurde, oder was auch immer. Ich musste lernen, den Pflegern zu vertrauen, dass sie die Situation in den Griff bekommen, und das lerne ich gerade. Ich kann das Leben meines Vaters nur begleiten, aber ich muss auch mein eigenes Leben leben und mich um mich kümmern. Ich habe leider viel zu lange für diese Erkenntnis gebraucht, wohl auch, weil mich Schuldgefühle plagten, obwohl mir die kluge Schwester Bernadette schon in Duisburg, als ich meinen Vater aus der Pflege abholte, warmherzig riet: „Frau Karrenbauer, lassen Sie Ihren Vater doch hier. Er hat sein Leben doch gelebt, Sie haben Ihres noch vor sich.“ Ich bereue es dennoch keine Sekunde, so gehandelt zu haben, wie ich es tat, auch wenn ich selbst wirklich auf vieles verzichtet habe. Ich habe eine Freundschaft zu meinem Vater gewonnen, und das kann mir niemand mehr nehmen.
Wie gelingt es Ihnen, Momente der Entspannung und Selbstfürsorge zu finden?
Darin war ich nie so gut. Aber jetzt nehme ich mir Auszeiten und ich bin erstaunt, dass mir das tatsächlich prima gelingt. Ich brauche viel Kraft und Stärke für mich selbst und erkläre ihm das auch genau so. Er ist sehr verständnisvoll im Gespräch, auch wenn er das meist direkt danach wieder vergessen hat. Ich verbringe meine freie Zeit mit Freunden, entspanne, wenn ich auf meinem kleinen Balkon die Blumen pflege, und bereite gerade meine nächsten Lesungen vor. Dazu habe ich gerade einen kleinen Trip mit dem Auto hinter mir, was ich sehr liebe, denn ich konnte schon immer beim Autofahren wunderbar „denken“, war bei meiner Mutter am Meer und habe den Weitblick auf die Ostsee genossen und habe mir in Bad Segeberg eine Probe der diesjährigen Karl-May-Spiele angesehen. Als Nico König bei meinem Abschied durch die ganze Arena rief: „Katy, wir lieben dich“, habe ich Rotz und Wasser geheult, denn ich dachte, genau das musst du selbst auch lernen. Dich zu lieben.
Was hat Sie dazu bewogen, Ihr Buch „Ich wollte einen Hund – jetzt hab ich einen Vater“ zu schreiben?
Viele Bücher werden erst dann geschrieben, wenn der andere nicht mehr lebt, sich aber auch somit dazu nicht mehr äußern kann und könnte. Ich wollte dieses Buch zu Lebzeiten meines Vaters schreiben, als eine Art „Station einer Krankheit“, aber auch für seine Erinnerung. Aber als es herauskam, war er innerlich so weit fort, dass ich einen Demenzschub befürchtete, wenn ich ihm das Buch zu lesen gebe. Darum habe ich es bis heute nicht getan.
Buchtipp

Was möchten Sie Menschen, die ähnliche familiäre Situationen durchleben, raten?
Ich wünschte, die Menschen würden offener über die Krankheit sprechen, vor allem im Familienkreis. Früherkennung ist wirklich wichtig und ich denke, mein Vater ist ein gutes Beispiel dafür, wie man mit viel Zeit, Liebe und Aufmerksamkeit wirklich noch eine sehr schöne Zeit mit einem dementen Menschen verbringen kann. Es gibt viele Hilfestellungen, die man nutzen kann, um das Vergessen zu verlangsamen. Darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Mir ging und geht es immer um die Würde des anderen, die ich zu erhalten versuche. Mein Vater trifft seine Entscheidungen selbst, auch wenn ich sie vielleicht in eine bestimmte Richtung hin „anrege“.
Was wünschen Sie sich für Ihren Vater, aber auch für Ihre eigene Zukunft?
Gesundheit und Zeit! Zeit! Zeit! Und dass sich sein „Vergessen“ für ihn nicht so anfühlt, wie es mich oft schmerzt.
Das Interview führte Emma Howe