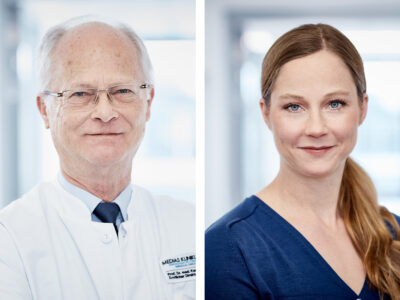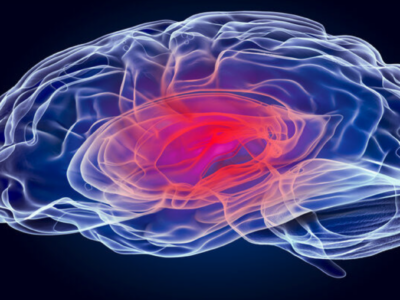Als Eva Leroy 2019 die Diagnose metastasierter Lungenkrebs erhält, ist sie 46 Jahre alt. Sie ist Mutter zweier Töchter, arbeitet als Erzieherin und steht mit ihrer Familie gerade am Anfang eines neuen Lebensabschnitts. Im Interview spricht sie über den Weg bis zur Diagnose, über körperliche und seelische Belastungen während der Behandlung und über die Frage, wie viel Ehrlichkeit Kinder aushalten können. Sie erzählt, warum Offenheit für sie ein zentraler Halt ist, wie sich ihr Blick auf Zeit und Prioritäten verändert hat und weshalb sie sich nicht auf ihre Krankheit reduzieren lässt.
Liebe Eva, wenn Sie auf Ihr Leben vor der Diagnose zurückblicken: Wer waren Sie damals?
Ich habe ein sehr normales Leben geführt. Ich war verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. 2019 war meine jüngere Tochter sechs Jahre alt und meine ältere 23. Wir waren gerade erst in unser Haus umgezogen und dabei, uns in Krefeld einzuleben. Ich habe als Erzieherin gearbeitet und meine Tochter kam in die Schule. Wir wollten uns hier ein neues Leben aufbauen, Kontakte knüpfen, Freunde finden. Es war ein schönes Familienleben. Mit all den Erwartungen und Hoffnungen, die man hat, wenn man denkt: Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt.
Dann kam eine Erkältung, die nicht mehr wegging.
Ja, sie zog sich über Wochen. Ich bekam verschiedene Medikamente, aber es wurde nicht besser. Rückblickend hatte ich mich schon Monate vorher nicht richtig wohlgefühlt. Mir war oft schwindelig und ich hatte dieses Gefühl, als würde ich durch ein Taschentuch atmen. Das habe ich beim Arzt auch immer wieder so beschrieben, doch keiner hatte eine Erklärung dafür. Ich hatte auch ein CT des Kopfs, aber da war alles unauffällig. Ich habe das alles lange auf Umzugsstress geschoben – Baustelle, Organisation, Neuanfang.
Wann wurde klar, dass es mehr ist als eine hartnäckige Infektion?
Erst beim Lungenfacharzt. Dort vermutete man zunächst eine atypische Lungenentzündung, ich wurde direkt ins Krankenhaus geschickt. Dort begann das Ausschlussverfahren. Ist es Sarkoidose? Ist es Tuberkulose? Oder ist es doch etwas anderes? Nach der Bronchoskopie stand fest: Lungenkrebs. Und sehr schnell ging es dann um die Mutationsanalyse. Die ist bei Lungenkrebs entscheidend, weil es nicht den einen Lungenkrebs gibt.
Was genau wurde bei Ihnen diagnostiziert?
Ein ALK-positiver, nicht kleinzelliger Lungenkrebs. Mit Metastasen in beiden Lungenflügeln. Diese Krebsform ist nicht primär mit Rauchen assoziiert. Ich habe früher geraucht, ja, aber hier geht es um eine genetische Veränderung im Zellkern. Davon gibt es sehr viele Varianten. Und sie bestimmen, welche Therapie überhaupt wirkt.
Sie sprechen heute sehr sachlich darüber. War das von Anfang an so?
Nein, natürlich nicht, aber ich habe früh gemerkt, dass mir Wissen hilft. Emotionen verändern meine Situation nicht, Information schon. Ich wollte verstehen, was in meinem Körper passiert, um Entscheidungen treffen zu können.
Wie sind Sie mit der Diagnose in Ihrer Familie umgegangen?
Ich war von Anfang an offen. Habe altersgerecht, aber ehrlich mit meiner Tochter kommuniziert. Ich bin Pädagogin und ich wusste, dass Schweigen nichts bringt. Kinder merken, wenn etwas nicht stimmt. Ich wusste selbst nicht, wohin die Reise geht. Ob ein Medikament wirkt. Ob ich leben darf oder sterben werde. In so einer Situation ist es besser, darüber sprechen zu dürfen, als in einer diffusen Angst zu leben.
Wie haben Ihre Kinder reagiert?
Meine ältere Tochter hat sogar eine Nacht mit mir im Krankenhaus verbracht. Das war ein sehr inniger Moment. Meine jüngere Tochter hat mich sehr überrascht. Es gibt eine Szene, die wir später auch im Kinderbuch aufgegriffen haben. Sie wird von einer Nachbarin gefragt, wo ihre Mama ist. Und sie sagt ganz offen und selbstverständlich: „Meine Mama hat Krebs. Ihr geht es gut. Sie kommt bald wieder nach Hause.“ Das hat mir gezeigt, dass sie damit umgehen kann und dass die gewählte Offenheit richtig war und sie stärk.
Sie sagen, die Frage „Wie geht es Ihrer Familie damit?“ empfinden Sie als schwierig. Warum?
Weil sie Verantwortung verschiebt. Wenn jemand wissen möchte, wie es meinem Mann oder meinen Kindern geht, dann sollte man sie fragen, nicht mich. Oft schwingt in dieser Frage Mitleid mit. Und Mitleid hilft nicht immer. Verständnis hingegen schon. Aber diese dauerhafte Fremdzuschreibung von Hilflosigkeit nimmt Menschen auch Würde.
Wie sieht Ihre Therapie heute aus?
Ich bekomme eine zielgerichtete Therapie in Tablettenform. Mit der passenden Mutation kann man damit lange leben. Bei mir kam eine zusätzliche Mutation dazu. Dadurch wurden die Abstände zwischen den Therapiewechseln kürzer. Ich hatte ein Medikament von 2019 bis 2023. Danach ein weiteres bis 2025. Aktuell bin ich in einem Early-Access-Programm. Studien sind hierzulande geschlossen, aber mein Onkologe konnte anhand einer erneuten Mutationsanalyse begründen, dass dieses Medikament für mich sinnvoll ist.
Haben Sie auch psychologische Unterstützung in Anspruch genommen?
Ja, direkt nach der Diagnose. Mir war klar, dass mein Partner viel auffängt, aber nicht alles. Ich wollte einen Raum, in dem ich Dinge aussprechen kann, ohne Rücksicht nehmen zu müssen. Das gibt mir bis heute eine gewisse Stabilität und Sicherheit.
Was hilft Ihnen im Alltag?
Was mir hilft, sind ganz einfache Dinge, wie Bewegung zum Beispiel. Walken, rausgehen, den Körper spüren. Ich male auch viel. Kleine Bilder, oft nur Postkartengröße. Manchmal ist es ein Gedanke, manchmal etwas, das ich beobachtet habe. Das Malen ordnet etwas in mir. Es hält fest, was sonst vielleicht einfach vorbeigehen würde. Und dann sind da die Begegnungen. Ein Kaffee, ein Gespräch, gemeinsam lachen oder auch einfach nur da sein. Ich habe gelernt, bewusster mit meinen Kontakten umzugehen. Nicht jeder passt dauerhaft zu mir, nicht jede Nähe fühlt sich gut an. Ich bin darin flexibler geworden. Und das ist in Ordnung. Und natürlich die Momente mit meiner Familie. Zu sehen, dass das Leben weitergeht und der Alltag bleibt, hilft mir sehr.
Sie engagieren sich auch in der Selbsthilfe. Wie ist es dazu gekommen?
Ich war eine Zeit lang in einer Selbsthilfegruppe in Düsseldorf. Der Austausch hat mir gutgetan, aber der Weg war auf Dauer schwierig. Nicht jeder kann oder will regelmäßig fahren. Mir wurde klar, dass mir ein Angebot vor Ort fehlt. Also habe ich die freie Selbsthilfegruppe Lungenkrebs Netzwerk Krefeld/Moers gegründet. Niedrigschwellig, ohne Vereinsstruktur und ohne Verpflichtungen. Man kommt, wenn man kann, und geht, wenn es zu viel wird. Im Mittelpunkt stehen Austausch, Gesehenwerden und das Wissen, nicht allein zu sein. Mir ist zudem wichtig, dass Betroffene wissen, wo sie Unterstützung bekommen. In nNGMs, das sind spezialisierte Netzwerke für moderne Lungenkrebsmedizin mit genauer Tumordiagnostik, und in zertifizierten Lungenkrebszentren kann man sich beraten lassen und jederzeit eine Zweitmeinung einholen. Auch der Verein zielGENau ist eine gute Anlaufstelle. Dort treffen sich Betroffene und Fachleute. Ärzte informieren über neue Therapieoptionen und beantworten Fragen.
Gemeinsam mit Julia Höfer haben Sie ein Kinderbuch veröffentlicht. Was war der Antrieb?
Ich habe lange nach Büchern gesucht, die Kindern erklären, was passiert, wenn ein Elternteil schwer erkrankt. Nicht auf einer medizinischen Ebene, nicht erklärend im Sinne von Diagnosen oder Therapien, sondern emotional. Ich habe vieles gefunden, vor allem zu Brustkrebs, aber kaum etwas zu Lungenkrebs. Und schon gar nichts, das die Perspektive von Kindern ernst nimmt, die mit einer metastasierten Erkrankung eines Elternteils leben. Gemeinsam mit Julia Höfer ist dann die Idee entstanden, ein Buch zu machen, das genau diesen Raum öffnet. Julia hat geschrieben, ich habe gemalt. So ist Schritt für Schritt dieses Buch entstanden. Es richtet sich an Familien mit Kindern, in denen ein Elternteil metastasiert erkrankt ist. Der Schluss bleibt bewusst offen. Nicht aus Unentschlossenheit, sondern weil das Leben offen ist. Weil niemand weiß, wie es weitergeht. Und weil genau das die Realität vieler Familien ist. Möglich wurde das Buch durch die Unterstützung des Bundesverbands Selbsthilfe Lungenkrebs e. V., der über Spenden die Finanzierung des Wunderbuchs ermöglicht hat.
Was möchten Sie Kindern und Eltern mit diesem Buch mitgeben?
Dass man über die Erkrankung sprechen darf. Dass man nichts verschweigen muss, um jemanden zu schützen. Ich glaube sehr daran, dass Ehrlichkeit trägt. Altersgerecht, mit den richtigen Worten, aber offen. Kinder spüren ohnehin, wenn sich etwas verändert. Sie bemerken Angst, Anspannung, Traurigkeit. Wenn sie keine Sprache dafür bekommen, bleiben sie allein damit.
Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?
Ich wünsche mir ein medizinisches Wunder. Ich sage das ganz bewusst so. Ich sehe, was Forschung heute möglich macht. Dinge, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren, sind heute Realität. Deshalb schließe ich Hoffnung nicht aus. Nicht aus Naivität, sondern weil sich etwas bewegt. Und weil es mir hilft, diesen Blick nach vorn zu behalten.
Buchtipp
Dieses Kinderbuch ist für Familien und Menschen, die sich mit einer metastasierten Krebserkrankung auseinandersetzen müssen.
Weitere Infos: www.wunderbuch.eu
Das Interview führte Emma Howe.