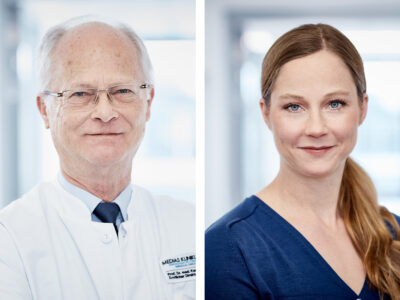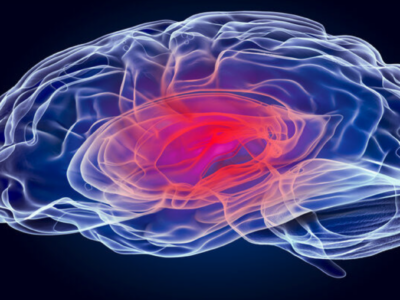Vor einem Jahr, als Renata Kellnerer 42 Jahre alt ist, wird bei ihr Darmkrebs diagnostiziert. Es beginnt eine Zeit, die ihr Leben grundlegend verändert. Neben der Erkrankung selbst prägen vor allem die Nebenwirkungen der Therapie ihren Alltag. Im Gespräch erzählt sie, wie sichtbar gewordene Hautveränderungen, Erschöpfung und Unsicherheit ihr Selbstbild beeinflusst haben.
Liebe Renata, Sie leben seit gut einem Jahr mit einer Krebsdiagnose und befinden sich mitten in der Behandlung. Was hat sich seitdem in Ihrem Leben verändert?
Alles! Am Anfang stand ich gefühlt wochenlang unter Schock. Die Diagnose Darmkrebs kam unerwartet, und von einem Tag auf den anderen drehte sich alles um Untersuchungen, Entscheidungen und Termine. Ich hatte das Gefühl, keine Zeit zum Nachdenken zu haben. Ich habe funktioniert. Ich habe gemacht, was notwendig war. Erst nach einigen Monaten habe ich gemerkt, dass nicht nur die Krankheit mein Leben verändert, sondern auch die Behandlung selbst. Mein Alltag wurde enger, mein Radius kleiner. Dinge, die früher selbstverständlich waren, brauchen heute mehr Planung und mehr Kraft.
Wann wurden Nebenwirkungen für Sie spürbar?
Sehr früh, schon in den ersten Wochen der Therapie. Zunächst habe ich sie kaum beachtet. Ich dachte, das ist normal und geht vorbei. Ich habe mir gesagt, dass das der Preis ist, damit die Behandlung wirkt. Aber es blieb nicht bei einzelnen Symptomen. Es kamen immer neue dazu. Veränderungen, die für sich genommen anfangs harmlos wirken, zusammen aber den Alltag spürbar verändert haben.
Welche waren das?
Vor allem die Müdigkeit. Diese tiefe Erschöpfung, die nicht verschwindet, egal wie viel man schläft. Dazu kam immer wieder Übelkeit, oft unterschwellig, aber dauerhaft. Mein Appetit hat stark nachgelassen, Essen war plötzlich keine Freude mehr, sondern etwas, das man hinter sich bringen musste. Und die Hautveränderungen waren ständig präsent: trockene Stellen, Rötungen, Pusteln, Spannungsgefühle. Ich hatte nie Probleme mit meiner Haut, auch nicht in der Pubertät. Doch meine Haut war plötzlich ein Thema, das mich durch den Tag begleitet hat.
Sie sagen, Sie haben das auch emotional gespürt.
Ja, denn die Haut ist schließlich sichtbar. Ich konnte sie nicht verbergen. Ich hatte das Gefühl, dass andere sofort sehen, dass etwas mit mir nicht stimmt. Dieser Gedanke war ständig präsent: man sieht mir die Therapie an. Das hat mein Selbstbild verändert. Ich habe mich unsicher gefühlt, beobachtet, manchmal auch verletzlich. Ich bin weniger unter Leute gegangen und habe Begegnungen vermieden, die mir früher leichtgefallen sind.
Haben Sie diese Beschwerden früh angesprochen?
Nein, ich habe lange gezögert. Ich dachte, das sei kein wichtiges Thema. Es geht ja um Krebs, nicht um Müdigkeit, Übelkeit oder Haut. Erst als die Beschwerden stärker wurden und mich wirklich belastet haben, habe ich darüber gesprochen. Heute weiß ich, dass das ein Fehler war. Nebenwirkungen sind kein Randthema. Sie gehören zur Therapie und beeinflussen, wie man lebt.
Was hat Ihnen schließlich geholfen?
Der Wendepunkt war das Gespräch mit einer onkologischen Pflegekraft. Sie hat sich Zeit genommen und wirklich zugehört. Sie hat mir erklärt, dass viele Krebstherapien gezielt in Zellprozesse eingreifen und dabei auch Haut, Schleimhäute und Nägel mitbetreffen. Das zu verstehen, war wichtig. Sie hat mir konkrete Pflege empfohlen, die speziell für Menschen in der Krebstherapie entwickelt ist. Produkte ohne Duftstoffe, ohne Alkohol, ohne reizende Zusätze. Cremes mit hohem Lipidanteil, die die Hautbarriere stabilisieren und rückfettend sind. Regelmäßiges Eincremen, nicht nur bei Spannungsgefühl, sondern vorbeugend. Morgens und abends, auch an Tagen, an denen die Haut scheinbar ruhig ist. Das hat meine Haut spürbar beruhigt und mir Sicherheit gegeben. Ich hatte endlich das Gefühl, selbst etwas tun zu können.
Was haben Sie gegen die anderen Nebenwirkungen getan?
Neben der Haut war die Erschöpfung am belastendsten. Diese Müdigkeit ist nicht mit normalem Müdesein vergleichbar. Sie verschwindet nicht durch Schlaf. Ich habe gelernt, sie ernst zu nehmen und nicht dagegen anzukämpfen. Ich habe meinen Alltag neu strukturiert, feste Ruhezeiten eingeplant, Aufgaben aufgeteilt. Ich habe akzeptiert, dass Konzentration begrenzt ist. Ich schreibe mir Dinge auf, ich plane weniger Termine und ich erlaube mir, langsamer zu sein. Auch hier hat Beratung geholfen – zu verstehen, dass Fatigue eine bekannte Nebenwirkung ist und kein persönliches Versagen. Kleine Bewegungseinheiten, frische Luft, klare Tagesstrukturen. Keine Überforderung, sondern Rhythmus. Heute weiß ich, dass Nebenwirkungsmanagement Teil der Therapie ist. Pflege, Pausen und Unterstützung sind kein Luxus. Sie helfen, die Behandlung durchzuhalten und Lebensqualität zu bewahren. Diese Erfahrungen haben meinen Alltag nachhaltig verändert. Ich plane bewusster, höre genauer auf meinen Körper und teile mir meine Energie ein. Wenn etwas nicht geht, akzeptiere ich das eher. Das war ein Lernprozess. Pausen sind heute notwendig, nicht verhandelbar. Ich sehe sie nicht mehr als Schwäche, sondern als festen Bestandteil meines Alltags.
Hat die Erkrankung Ihren Blick auf sich selbst verändert?
Ja, ich bin achtsamer geworden. Ich nehme Veränderungen früher wahr und spreche sie an. Ich habe verstanden, dass Lebensqualität nichts Selbstverständliches ist. Man muss sich aktiv darum kümmern, gerade während einer Therapie.
Was möchten Sie anderen Betroffenen mitgeben?
Nehmen Sie Nebenwirkungen ernst. Sprechen Sie früh darüber. Sie müssen nichts aushalten oder allein bewältigen. Auch Unterstützung anzunehmen gehört zur Behandlung dazu.
Das Interview führte Emma Howe.