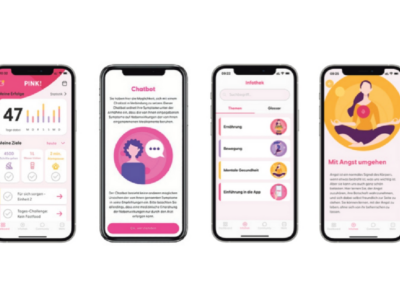Vor wenigen Wochen erhielt Sabrina (42) die Diagnose Brustkrebs – eine Nachricht, die ihr Leben von einem Tag auf den anderen auf den Kopf stellte. Eigentlich war es nur eine Routineuntersuchung, ohne Beschwerden, ohne Verdacht. Doch dann folgte der Ultraschall, die Biopsie, das Warten – und schließlich die Wörter, die alles veränderten: Sie haben Brustkrebs. In dem Moment, als die Ärztin die Diagnose aussprach, fühlte es sich für Sabrina an, als würde der Boden unter ihren Füßen wegbrechen. So einzigartig und persönlich diese Erfahrung ist, so viele Frauen teilen sie jedes Jahr. In Deutschland erkranken jährlich etwa 80.000 Frauen neu an Brustkrebs – damit ist es die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Und hinter jeder dieser Zahlen steht ein Schicksal, eine Familie, eine Geschichte, die von Angst, Hoffnung und einem neuen Blick auf das Leben erzählt.
In diesem Interview spricht Sabrina offen darüber, wie sie den Moment der Diagnose erlebt hat, wie sie es ihrer Familie mitgeteilt hat und was ihr heute Kraft gibt, den Weg durch diese herausfordernde Zeit zu gehen.
Liebe Sabrina, danke, dass du bereit bist, mit mir über deine aktuelle Situation zu sprechen. Du hast vor wenigen Wochen die Diagnose Brustkrebs erhalten. Kannst du erzählen, wie dieser Moment für dich war?
Ja, natürlich. Es war ein ganz normaler Dienstag. Ich war zur Routinekontrolle bei meiner Frauenärztin – nichts Ungewöhnliches, ich hatte keine Beschwerden. Bei der Tastuntersuchung meinte sie dann, dass sie zur Sicherheit eine weitere Abklärung möchte. Ich bekam eine Überweisung zum Ultraschall in einer radiologischen Praxis. Dort wurde ein auffälliger Befund festgestellt – ein Schatten, der weiter untersucht werden musste. Ich dachte erst, das sei bestimmt ein Irrtum. Doch nach einer Biopsie und ein paar bangen Tagen saß ich dann beim Onkologen – und bekam die Diagnose: invasives Mammakarzinom, linksseitig. In dem Moment hat sich alles um mich herum aufgelöst. Ich habe zwar die Wörter gehört, aber sie sind nicht wirklich bei mir angekommen.
Was war dein erster Gedanke?
„Das kann nicht sein.“ Ich bin 42, habe zwei Kinder, ernähre mich gesund, rauche nicht, mache regelmäßig Sport. Ich fühlte mich nie krank. Mein erster Gedanke war wirklich: Das muss eine Verwechslung sein. Vielleicht haben die Ärzte die Ergebnisse vertauscht, vielleicht gibt es eine andere Erklärung. In meinem Kopf ratterte es, ich suchte nach jedem Strohhalm, um diese Diagnose nicht wahrhaben zu müssen. Und dann kam sofort die Angst – nicht so sehr um mich, sondern um meine Kinder. Was passiert mit ihnen, wenn ich das nicht schaffe? Der Gedanke, dass ich sie vielleicht nicht aufwachsen sehen könnte, dass ich bei so vielen wichtigen Momenten fehlen würde, schnürte mir die Kehle zu. Gleichzeitig spürte ich eine Art Ungläubigkeit, als ob ich in einem schlechten Film sitze, der aber nichts mit meinem Leben zu tun hat. Ich erinnere mich noch genau an dieses Gefühl von Schockstarre – alles um mich herum lief weiter, aber in mir war nur Leere und ein ohrenbetäubendes Rauschen. In diesem Moment wurde mir klar, wie fragil alles ist, wie schnell ein Alltag, den man für selbstverständlich hält, in 1.000 Stücke zerfallen kann.
Wie hast du es deiner Familie gesagt?
Das war der schwerste Moment für mich. Ich wollte stark wirken, aber innerlich war ich völlig aufgewühlt. Ich habe zuerst mit meinem Mann gesprochen. Wir saßen lange einfach nur da, ohne Worte. Irgendwann haben wir uns einfach umarmt, und in dieser Umarmung war gleichzeitig so viel Angst und so viel Halt. Bei den Kindern – sie sind neun und zwölf – haben wir versucht, es altersgerecht zu erklären. Dass Mama krank ist, aber in guten Händen. Dass die Ärzte alles tun werden, damit ich wieder gesund werde. Es war mir wichtig, ehrlich zu sein, aber trotzdem Hoffnung zu geben. Gleichzeitig hatte ich große Sorge, die Kinder zu überfordern oder ihnen zu viel Angst zu machen. Sie haben viele Fragen gestellt: „Wirst du deine Haare verlieren? Kann man davon sterben?“ – und das hat mir fast das Herz zerrissen. Wir haben versucht, auf jede Frage so ehrlich wie möglich zu antworten, ohne ihnen die ganze Schwere zuzumuten. Danach war es eine Weile still, und dann haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir als Familie stark sein wollen – auch wenn das bedeutet, dass es Tränen und schlechte Tage geben wird. Ich habe gemerkt, wie wichtig es war, den Kindern zu signalisieren: Ihr dürft alles fühlen, ihr dürft fragen, ihr dürft traurig sein. Für mich war das Gespräch ein Wendepunkt – ein Moment, in dem klar wurde: Wir schaffen das nur zusammen.
Wie geht es dir heute, ein paar Wochen nach der Diagnose?
Ich bin in so einer Art Zwischenzustand. Die Diagnose liegt hinter mir, aber die Therapie steht mir noch bevor. Ich hatte schon mehrere Gespräche mit meiner Onkologin. Es wird eine Operation geben, bei der ein Teil der Brust entfernt wird, danach folgt wahrscheinlich eine Chemotherapie. Ich schwanke zwischen Angst, Unsicherheit – aber auch Klarheit. Ich weiß jetzt, was auf mich zukommt. Ich habe angefangen, mich zu informieren, Fragen zu stellen, Hilfe anzunehmen. Ich versuche, Schritt für Schritt zu gehen, nicht zu weit in die Zukunft zu denken.
Wie gehst du emotional mit der Diagnose um?
Es ist ein ständiges Auf und Ab. Manche Tage sind okay – ich funktioniere, organisiere, plane. Und dann gibt es Tage, an denen ich einfach nur weine. Ich bin wütend, traurig, erschöpft. Aber ich habe gelernt, mir diese Gefühle zu erlauben. Ich versuche nicht mehr, die Starke zu sein. Ich bin verletzlich – und das ist in Ordnung. Was mir sehr hilft, ist Schreiben. Ich führe ein Tagebuch, in dem ich alles rauslasse. Es ist wie ein Ventil.
Hast du Unterstützung von außen?
Ja, und dafür bin ich unglaublich dankbar. Eine gute Freundin von mir hatte selbst vor ein paar Jahren Brustkrebs und begleitet mich jetzt. Sie kennt die medizinischen Abläufe, aber auch die emotionalen Achterbahnfahrten. Wir reden sehr viel miteinander. Durch Social Media weiß ich zudem, dass es so viele junge Frauen gibt, die diesen Weg gegangen sind – und heute wieder gesund sind. Das gibt mir unglaublich viel Kraft.
Hat sich dein Blick auf das Leben verändert?
Total. Ich habe früher oft Dinge aufgeschoben, mich gestresst über Kleinigkeiten, mich selbst unter Druck gesetzt. Jetzt weiß ich: Nichts ist selbstverständlich. Nicht der Kaffee am Morgen, nicht ein Spaziergang mit meinem Sohn, nicht das Lachen meiner Tochter. Ich versuche, im Moment zu leben. Dankbarkeit ist nicht nur ein Wort – ich spüre sie jetzt wirklich. Für jeden Moment, in dem ich mich lebendig fühle.
Viele Menschen wissen nicht, wie sie reagieren sollen, wenn jemand in ihrem Umfeld an Krebs erkrankt. Was hättest du dir gewünscht?
Ich habe beides erlebt: liebevolle Reaktionen und auch ziemlich ungeschickte. Manche Menschen meiden mich jetzt, wahrscheinlich weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Andere überschütten mich mit Ratschlägen oder erzählen Horrorgeschichten von Bekannten, die gestorben sind. Das ist schwer auszuhalten. Ich wünsche mir, dass Menschen einfach da sind. Zuhören, ohne zu bewerten. Es reicht oft schon zu sagen: „Ich bin für dich da.“ Und bitte nicht: „Du musst nur positiv denken.“ Ich darf auch Angst haben, und das ist okay. Noch hilfreicher wäre es, wenn Freunde und Bekannte akzeptieren, dass jede Situation anders ist, dass es keine richtigen oder falschen Gefühle gibt und dass Schweigen manchmal mehr Trost spenden kann als ein gut gemeinter, aber verletzender Satz. Ein ehrliches Gespräch, eine kleine Geste der Nähe oder einfach gemeinsam Zeit verbringen – all das bedeutet viel mehr, als vermeintlich kluge Ratschläge zu geben. Was ich mir am meisten wünsche, ist Verständnis und die Bereitschaft, Unsicherheit auszuhalten, anstatt sie mit Phrasen zu überdecken.
Was gibt dir aktuell am meisten Kraft?
Meine Familie. Die Umarmungen meiner Kinder, die Liebe meines Mannes. Aber auch der Glaube an mich selbst. Ich habe Seiten an mir entdeckt, die ich vorher gar nicht kannte. Ich bin verletzlich, ja – aber auch stark. Ich habe mir eine kleine Routine aufgebaut: Meditation am Morgen, kurze Spaziergänge, Musik hören. Ich nehme Hilfe an, mache psychologische Beratung, lasse mich tragen, wenn ich nicht mehr kann. Und ich plane kleine Lichtblicke – ein Kinobesuch, ein Wochenende am Meer. Das gibt mir ein Gefühl von Normalität.
Gibt es etwas, das du anderen Frauen in ähnlicher Situation mit auf den Weg geben möchtest?
Auf jeden Fall. Zuerst: Du bist nicht allein. Diese Diagnose ist ein Schock, aber sie ist nicht das Ende. Hol dir Hilfe, informiere dich, aber überfordere dich auch nicht mit zu vielen Informationen auf einmal. Vertrau auf dein Gefühl. Und sprich über deine Emotionen. Schweigen macht alles nur schwerer.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Natürlich wünsche ich mir, gesund zu werden. Aber darüber hinaus wünsche ich mir, dass ich mir meine neue Sicht auf das Leben bewahre. Dass ich das, was wirklich zählt – Liebe, Nähe, Ehrlichkeit –, nie wieder aus den Augen verliere.
Das Interview führte Leonie Zell