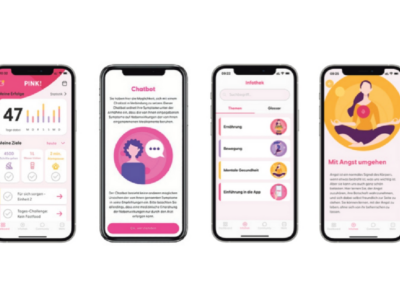Die Beschwerden, beispielsweise starke krampfartige Schmerzen in der Nierengegend, können wie aus dem Nichts kommen und die Erkrankten unvorbereitet treffen. Dabei spielt das Alter keine Rolle: Die primäre Hyperoxalurie Typ 1 tritt bei Säuglingen ebenso auf wie bei Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen.1 Oft sind Nierensteine das erste Anzeichen, dass es durch die Erkrankung zu einer Überproduktion von Oxalat kommt. Es reichert sich im Körper an und kann sich in Form von Kalziumoxalatkristallen in verschiedenen Geweben und Organen ablagern und diese schädigen.2
Der Name primäre Hyperoxalurie steht für eine Gruppe von Erkrankungen, von denen die primäre Hyperoxalurie Typ 1 (PH1) die häufigste und schwerste Form ist.1 Die Erkrankung ist genetisch bedingt und sehr selten: Von einer Million Menschen in Europa und Nordamerika haben einer bis drei eine PH1.2 Schätzungsweise die Hälfte der Betroffenen hat keine Diagnose erhalten3 – sie wissen nichts von ihrer Erkrankung. Begründet ist dies darin, dass die unspezifischen Symptome von Ärzten gerade bei Erwachsenen nicht mit der seltenen Erkrankung in Zusammenhang gebracht werden oder die Betroffenen nicht deutbare Beschwerden haben.4,5
Die Anzeichen richtig deuten
Bei Kindern kann bereits der erste Nierenstein ein Anzeichen für eine PH1 sein. Daher muss die Ursache ärztlich abgeklärt werden.2 Aber auch eine Gedeihstörung – Wachstumsverzögerung oder fehlende Gewichtszunahme – oder bereits bekannte Nierensteinerkrankungen in der Familie sind bei Kindern Warnzeichen für eine PH1.6 Oft wird die Erkrankung erst erkannt, wenn die Nieren stark geschädigt sind. Im Mittel vergehen fünfeinhalb Jahre vom Auftreten erster klinischer Symptome bis zur Diagnose.7 In dieser Zeit kann die Krankheit fortschreiten und die Organe – vor allem die Nieren – schädigen. Daher ist es wichtig, bei Kalziumoxalatsteinen genau hinzusehen und darauf zu drängen, die Ursache abzuklären. Das bedeutet, jeder Nierenstein muss biochemisch analysiert werden.8 Das gilt besonders, wenn im Erwachsenenalter immer wieder Nierensteine auftreten.9
Diese Anzeichen können auf eine PH1 hinweisen:
• Schmerzen in der Seite
• Schmerzen beim Wasserlassen
• Blut im Urin (Hämaturie)
• Harnwegsinfektionen
• Ausscheiden von Steinen mit dem Urin
Treten Anzeichen für eine PH1 auf, ist ärztlicher Rat wichtig, um die Nieren zu schützen.
Oft lange Zeit ohne Symptome
Doch nicht immer kommt es zu Nierensteinen. Auch Kalziumablagerungen im Nierengewebe (Nephrokalzinose) und ein fortschreitender Rückgang der Nierenfunktion sind mögliche Folgen der erhöhten Oxalatproduktion. Das Tückische dabei: Die Ablagerungen in den Nieren verursachen bei einigen Betroffenen lange Zeit keine Beschwerden. Die Erkrankung verläuft schleichend und manchmal bis ins Erwachsenenalter ohne Symptome.10
Unbehandelt schreitet die Erkrankung fort
Bleibt die Erkrankung unbehandelt, verschlechtert sich die Nierenfunktion bis hin zum lebensbedrohlichen Nierenversagen. 20 Prozent der Betroffenen entwickeln bis zum Alter von 18 Jahren ein terminales Nierenversagen, die Hälfte bis zum vierten Lebensjahrzent.3 Bei einem terminalen Nierenversagen wird nur extrem wenig Urin produziert. Treten Anzeichen eines Nierenversagens auf, ist rascher ärztlicher Rat in einer Klinik oder Praxis wichtig. Wie schnell die PH1 fortschreitet, ist individuell verschieden. In einigen Fällen geschieht dies sehr schnell, daher ist eine frühzeitige Diagnose und Behandlung wichtig, um die Nierenfunktion bestmöglich zu erhalten und der Ablagerung von Kalziumoxalatkristallen in anderen Geweben vorzubeugen. Denn wenn die Nieren Oxalat nicht ausscheiden können, kommt es zu einer sogenannten systemischen Oxalose. Dabei lagert sich Kalziumoxalat beispielsweise in der Haut, den Blutgefäßen, den Knochen, Gelenken, Muskeln und peripheren Nerven, aber auch in der Netzhaut des Auges, den Zähnen und dem Herzen ab. Die Folgen können unwiderrufliche Organschäden sein.10
PH1 – was ist die Ursache?
Bei der PH1 führt eine Genmutation dazu, dass Enzyme in der Leber nicht richtig funktionieren und zu viel Oxalat gebildet wird. Das beruht darauf, dass ein Teil des Stoffwechsels, der die Leberenzyme Glykolatoxidase (GO) und Alanin-Glyoxylat-Transferase (AGT) nutzt, nicht funktioniert. Bei gesunden Menschen führt das Zusammenspiel der beiden Enzyme zur Produktion einer Aminosäure, die zum Bau von Eiweißstoffen genutzt wird. Bei der PH1 hingegen funktioniert die GO, aber die AGT ist geschädigt. Dadurch wird statt der Aminosäure zu viel Glyoxylat gebildet, aus dem in weiteren Stoffwechselschritten Oxalat entsteht. Es reichert sich an und verbindet sich mit Kalzium zu schwer löslichen Kristallen. Lagern sich diese Kristalle zu größeren Gebilden zusammen, entstehen Nierensteine oder die Kristalle lagern sich ins Gewebe ein. Die Schädigungen am Nierengewebe führen dazu, dass die Nieren ihre Funktion, Abfallstoffe aus dem Blut herauszufiltern und über den Urin aus dem Körper auszuscheiden, nicht mehr richtig ausführen können.1,2,4,5
Diagnose und Behandlung der PH1
Besteht der Verdacht auf eine PH1, bestimmt der Arzt die Oxalatkonzentration im 24-Stunden-Urin oder, bei eingeschränkter Nierenfunktion, im Blutplasma. Zudem wird die Nierenfunktion untersucht. Ergeben sich dabei weitere Hinweise auf eine PH1, führt eine genetische Testung zur gesicherten Diagnose.2,4 Ist die Diagnose gestellt, ist eine konsequente, lebenslange Behandlung erforderlich.2 Für die Betroffenen ist es unter anderem wichtig, sehr viel – mehr als zwei bis drei Liter pro Quadratmeter Körperoberfläche – zu trinken. Das bedeutet, ein Erwachsener mit einer Körpergröße von 1,75 Meter und einem Gewicht von
78 Kilogramm muss mehr als 1,7 bis 2,5 Liter pro Tag trinken. Ob eine medikamentöse Behandlung oder eine Dialyse notwendig ist, entscheidet der Arzt anhand des vorliegenden individuellen Krankheitsbildes.
Für weitere Informationen und Hinweise zur Diagnose einer PH1 sowie Tipps zum Leben mit der Erkrankung besuchen Sie die Internetseite www.livingwithph1.eu/de. Zudem gibt es dort ein PH1-Handbuch, einen Leitfaden zum Aufwachsen mit PH1, Patientenberichte sowie eine Liste mit Zentren, die Erfahrungen mit der Diagnose und Behandlung von PH1 haben.
Literatur:
1Cochat P et al. Arch Dis Child 2000, 2www.orpha.net/de/disease/detail/416, ³Hopp K, Cogal AG, Bergstralh EJ, et al. J Am Soc Nephrol. 2015;26:2559-2570, 4Groothoff JW et al. Nat Rev Nephrol. 2023;19(3):194–211, 5Milliner DS et al. www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1283/; Stand: 04.02.2025, 6Cochat P et al. J Pediatr 1999;135:746–750, 7van der Hoeven SM, van Woerden CS, Groothoff JW. Nephrol Dial Transplant. 2012;27:3855-3862, 8www.register.awmf.org/de/leitlinien/detail/043-025, 9Groothoff JW et al. Nat Rev Nephrol. 2023;19:194-211, 10Hoppe B, Beck BB, Milliner DS. Kidney Int. 2009;75(12):1264-1271
Der Artikel wurde in Zusammenarbeit mit Alnylam umgesetzt.