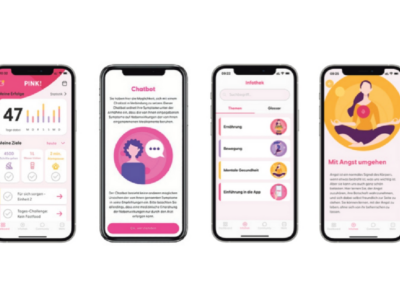Wolfram Gössling arbeitet seit 25 Jahren als Onkologe an der Harvard Medical School. 2013 wurde ein Angiosarkom in seinem Gesicht diagnostiziert. Seine Überlebenschance lag bei vier Prozent.
Als der Krebs an meine Tür klopfte, war ich auf ihn nicht vorbereitet. Die Diagnose habe ich an einem Montagmorgen erhalten. Ich stand im Hörsaal vor Studenten, hielt eine Vorlesung und bekam auf meinem Piepser die Nachricht, dass ich mich sofort bei meinem Hautarzt melden sollte. In dem Moment fiel mir ein, dass ich eine Woche zuvor eine Hautbiopsie von einem Pickel auf meiner Wange hatte. Ich entschuldigte mich kurz bei den Studenten, verließ den Saal und rief meinen Arzt an. Der teilte mir mit, dass ich ein Angiosarkom habe, und fing an zu weinen. In diesem Moment bekam ich Angst, denn wenn ein Arzt weint, muss es wirklich schlimm sein. Da stand ich in diesem Krankenhausflur, um mich herum das Leben – und ich war völlig allein. Ich ging zurück in den Hörsaal, wo die 30 Studenten auf mich warteten, und beendete die Vorlesung. Das war sicherlich nicht meine beste – es ging in diesem Moment nur darum, die nächste Folie zu schaffen. Und so ist es auch für Krebspatienten: Es geht immer darum einen Schritt nach dem anderen zu machen.
Nach der Diagnose begann ich zu lernen, ein Patient zu sein, und zu begreifen, was es bedeutet, wenn auf einmal das Leben auf der Kippe steht und man die Kontrolle über sein Leben in die Hände von Medizinern abgeben muss. Das war sehr schwer für mich.
Die härteste Zeit während der Therapie war die Bestrahlung. Mein Radioonkologe hatte eine Maske für mich angefertigt, die mein gesamtes Gesicht abdeckte, da um den Tumor herum bestrahlt wurde. Zu Beginn der Behandlung sagte mein Strahlentherapeut: „Das wird hart, wir müssen bei der Behandlung bis an die Grenze gehen. Ich werde dich bis an den Rand einer Klippe führen, dich über dem Abgrund baumeln lassen und dich an deinen Füßen festhalten – und dann ziehen wir dich wieder zurück ins Leben.“ Genau so hat sich das auch angefühlt. In der letzten Phase der Behandlung gab es während der Bestrahlung Momente, an denen ich dachte, dass es nicht mehr weitergeht. Ich fühlte mich im Fall und niemand hielt mich fest. Doch sie haben mich zurückgezogen.
Krebs und Krebsbehandlung bedeuten immer Beeinträchtigung und Verlust. Bei mir konnte man dem auch körperlich und visuell nicht entfliehen. Der komplette Bereich rund um den Tumor musste entfernt werden. Krebs nimmt Funktionen, Identität und Aussehen. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass Krebs auch den Verlust des eigenen Ichs und der eigenen Persönlichkeit bedeuten kann. Man ist danach einfach nicht mehr der Alte.
Ich hatte große Angst davor, dass meine Kinder mich nicht wiedererkennen. Als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, lief meine damals fünfjährige Tochter auf mich zu, schaute mich an und sagte: „Papa, du siehst aber komisch aus, ich habe dich trotzdem lieb.“ Sie umarmte mich und spielte weiter. Meine Kinder nahmen meine Veränderung wahr, urteilten aber nicht. Das half mir sehr. Dennoch habe ich Monate gebraucht, um mich an mein neues Ich und mein neues Aussehen zu gewöhnen.
In den letzten zehn Jahren hat ein Paradigmenwechsel in der Krebstherapie stattgefunden. Jeder Tag, den man als Krebspatient am Leben bleibt, erhöht die Chance, dass sich eine neue Handlungsmöglichkeit auftut und damit eine neue Chance, gerettet und geheilt zu werden. Die Zeit arbeitet für einen.
Meine Wandlung vom Krebsarzt zum Krebspatienten war schmerzhaft und entbehrungsvoll. Und ich kann nicht wirklich beurteilen, ob mich die Krankheit zu einem fähigeren Arzt gemacht hat – aber dass ich ein anderer Arzt geworden bin, ist sicher. Weil ich das, was meine Patienten erleben, am eigenen Leib erfahren habe.
BUCHTIPP
Am Leben bleiben: Ein Onkologe bekämpft seinen Krebs
Wolfram Gösslings Buch ist ein Plädoyer für die Hoffnung. Denn er weiß: Betroffene brauchen Positivgeschichten. Trotz und alledem.
ISBN-10: 3499006057
ISBN-13: 978-3499006050